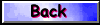Andersch, Alfred: Die Kirschen der Freiheit.
Diogenes Verlag (1952) 1968, 120 Seiten
In diesem autobiographischen Bericht schildert Andersch einige Szenen aus seinem
Leben als Kind, Jugendlicher und junger Mann. Diese Szenen stellen wichtige
Situationen in seinem Leben dar und geben Aufschluss darüber, was er dachte, fühlte
und wie er handelte. Der Bericht umfasst die Zeitspanne von 1919 bis 1944. In
politischer Hinsicht eine äußerst unruhige Zeit und im Leben des Einzelnen
traumatisierende Jahre (Untergang der Weimarer Republik, Aufkommen des
Faschismus und Krieg). Andersch geht von persönlichen Erlebnissen aus, verweilt dort jedoch nicht lange und
spannt den Bogen zu größeren Ereignissen und Themen seiner Zeit. Dabei ist er
äußerst offen, nimmt sich selbst, seine Empfindungen und Lebensauffassungen
sehr ernst und teilt diese selbstverständlich mit. Seine Einstellung zu den
Problemen der Zeit ist non-konformistisch und weicht von der Mehrheit ab. Das
ist besonders bewundernswert, da persönliche Freiheit und Individualität
unterdrückt wurden. Es herrschte eine „Vermassung“ der Menschen durch Einflüsse
des Nationalismus, Militarismus und kollektiven Denkens. Ziel des NS-Regimes war
es, einen einheitlich denkenden Menschen zu schaffen, damit er besser in den
Griff zu bekommen war und über ihn geherrscht werden konnte. Andersch wehrt
sich dagegen und findet den Mut, sich gegen die Tyrannei zu stellen und einen
eigenen Weg zu gehen. Er möchte nicht in der Masse untergehen und das gleiche
Schicksal erleiden wie tausend andere, die ihr Leben für's Vaterland auf dem
Schlachtfeld lassen. Er möchte aus der Masse herausragen und aus seinem Leben etwas Einmaliges machen. Das kollektive
Schicksal, egal wie tröstlich es ist, ist ihm zuwider.
In seinem autobiographischen Bericht will Andersch’ dem Leser implizit
vermitteln, dass jeder Mensch auch in schwierigen Situationen in der Lage ist,
sein Schicksal aktiv in die Hand zu nehmen und es nicht äußeren Mächten oder
dem Zufall zu überlassen. In Andersch’ Leben ist der 6. Juni ein wichtiges
Datum. An diesem Tag desertiert er aus der Armee und geht zu den Amerikanern über.
Nach seinen Worten wählte er in einem bestimmten Augenblick die Tat, die seinem
Leben Sinn verlieh und "von da an zur Achse wurde, um die sich das Rad meines Lebens drehte" (S. 71). Hier macht sich der Einfluss der Existenzphilosophie auf das
Denken Andersch’ bemerkbar, die besagt, dass der Mensch zur Freiheit verdammt
ist. Nach dieser Philosophie ist der Mensch zwar durch die Faktizität (Geburt,
Familie, soziale Schicht, Zeitgeist, Epoche usw.) festgelegt, aber dennoch
verbleibt dem einzelnen eine gewisse Freiheit, aus den gegebenen Umständen
etwas Einmaliges und Unverwechselbares zu machen. Mit dem Freiheitsbegriff eng
verknüpft sind die Begriffe „Verantwortlichkeit“ und „ethisches
Handeln“. Der Mensch ist nicht nur frei, sondern er hat auch Verantwortung zu
tragen für seine Taten, die ethisch hochstehend sein müssen. Er muß jederzeit
vor sich selbst und vor den anderen bestehen und sein Gesicht wahren können.
Andersch geht mit sich selbst hart ins Gericht und tadelt sich, wenn er
feststellt, daß er zu einer bestimmten Zeit oder in einer bestimmten Situation
moralisch versagt hat.
Als Fünfjähriger wird Andersch Augenzeuge, wie gefangene Rotarmisten (nach dem
Scheitern der Münchner Räterepublik) durch die Straßen getrieben und anschließend
hingerichtet werden. Sein Vater steht neben ihm und sagt: „Das Gesindel“ (S.
9). Was der kleine Alfred dabei empfindet, erfährt der Leser nicht. Dies ist
jedoch nicht schwer herauszufinden: Die politische Einstellung des Sohnes hat
sich später als völlig entgegengesetzt erwiesen. Während der Vater
erzkonservativ war und mit dem Nazi-Regime sympathisierte, hing der Sohn
fortschrittlichen Ideen an und trat als junger Mann in die kommunistische Partei
ein. Wir können davon ausgehen, dass die Sympathie des Fünfjährigen den
Todgeweihten gegolten haben muss.
Andersch beschreibt seinen Vater, nachdem dieser verwundet aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrt,
als einen gescheiterten und gebrochenen Mann. Die Wunde am Bein, die er sich im
Krieg zugezogen hatte, brach immer wieder auf, so dass ihm schließlich das Bein
amputiert werden musste. Der Sohn erlebte, wie der Vater zugrunde ging. Hier
muss der junge Andersch geschworen haben: „So wie mein Vater möchte ich auf
keinen Fall enden“.
Andersch tritt als 16-jähriger in die kommunistische Partei ein und übernimmt einen
aktiven Posten. Er wird bald festgenommen und für drei Monate im
Konzentrationslager Dachau eingesperrt. Als er erneut festgenommen wird, gerät
er in panische Angst und spürt, wie gefährdet sein Leben ist. Wieder
freigelassen beendet er seine Tätigkeit für die kommunistische Partei und
bleibt zeitlebens parteilos.
Mit der anschließenden Übersiedlung nach Norddeutschland fängt für Andersch eine
neue Lebensphase an: Er geht in die Innerlichkeit. Er versucht, zu sich selbst
zu finden. Bei diesem Prozess hilft ihm die Kunst (Architektur, Malerei, Musik,
Literatur). „Ich antwortete auf den totalen Staat mit der totalen Introversion
(...) Das war im Sinne Kierkegaards die ästhetische Existenz, marxistisch
verstanden der Rückfall ins Kleinbürgertum, psychoanalytisch eine Krankheit
als Folge des traumatischen Schocks, den der faschistische Staat bei mit erzeugt
hatte“ (S 46).
Andersch ist ein entschiedener Kriegsgegner und versucht, dem Kriegsschauplatz fern zu
bleiben. Den militärischen Behörden legt er medizinische Gutachten vor, damit
er als untauglich eingestuft wird. Seine Bemühungen scheitern jedoch, und er
wird an die Kampffront beordert. Als Soldat an der Südfront (Italien) reift bei
ihm der Gedanke, aus der Armee zu desertieren. Er vollzieht diesen Schritt am 6.
Juni 1944 bei Viterbo, etwa 60 Kilometer nördlich von Rom.
Die existentielle Entscheidung, die Freiheit zu ergreifen und die Verantwortung für
das eigene Leben zu übernehmen, steht im Mittelpunkt von Andersch’ Bericht.
„In jenem winzigen Bruchteil einer Sekunde, welcher der Sekunde der
Entscheidung vorausgeht, verwirklicht sich die Möglichkeit der absoluten
Freiheit, die der Mensch besitzt. Nicht im Moment der Tat selbst ist der Mensch
frei, denn indem er sie vollzieht, stellt er die alte Spannung wieder her, in
deren Strom seine Natur kreist. Aufgehoben wird sie nur in dem einen flüchtigen
Atemhauch zwischen Denken und Wollen. Frei sind wir nur in Augenblicken. In
Augenblicken, die kostbar sind. Mein
Buch hat die Aufgabe: einen einzigen Augenblick der Freiheit zu beschreiben
(...) Wie viele lebende Leichname gibt es, die – mag ihr Fleisch noch so blühen
– gestorben sind, weil sie entweder die Angst oder den Mut, die Vernunft oder
die Leidenschaft aus sich ausgerottet haben? Worauf es ankommt, ist: sich die
Anlage zur Freiheit zu erhalten“. (S.83)
Dipl.-Psych. Dr. Najib Arabu, Berlin Okt. 2002

Die Kirschen der Freiheit. Ein Bericht.