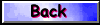Jaeggi, Eva: Und wer therapiert die Therapeuten?, Stuttgart
2001, 227 Seiten
Besonders gut ist der Titel eigentlich nicht gewählt, legt er doch nahe,
daß Kranke sich zu Therapeuten aufschwingen. Es ist dann nicht mehr weit zum
Diktum von Karl Kraus, wonach die Psychoanalyse die Krankheit sei, für deren
Therapie sie sich ausgebe.
Die Autorin, selbst von der Verhaltenstherapie kommend, in höherem Alter
noch die Mühen einer psychoanalytischen Weiterbildung auf sich nehmend, befaßt
sich dann differenziert mit der Problematik seelischer Gesundheit in diesem hoch
infektiösen Beruf.
Wenn es auch Menschen in diesem Feld gibt, die 40 Stunden in der Woche
psychotherapeutisch tätig sein können, so schließt sie dies für sich aus.
Sie bekennt, gerne Psychotherapeutin zu sein, ist aber zugleich froh, nicht
ausschließlich damit ihren Lebensunterhalt bestreiten zu müssen. Die
permanente Konfrontation mit dem Innenleben anderer, die ewige Kontrolle der
eigenen Gefühle, die tägliche Begegnung mit den oft negativen Emotionen der
anderen, verlangt nach einem ausgleichenden Schwergewicht, das Jaeggi für sich
in der wissenschaftlichen Arbeit gefunden hat. Und in diesem Feld, ein
universitäres Projekt über den "Beruf der Psychotherapeuten",
entstand denn auch der vorliegende Text.
Damit ist ein wesentliches Moment, die eigene Gesundheit zu erhalten,
bereits genannt. In erfreulicher Offenheit schildert Frau Jaeggi ebenso eine der
größten Gefahren: Der dem priesterlichen Vorbild nahestehende Größenwahn,
der sich im therapeutischen Furor Bahn bricht, bei entsprechender Konfrontation
mit dem real Möglichen, dem Kleinheits- und Minderwertigkeitsgefühl anheim
fällt. Darin scheint der Kern des Burnout beim Psychotherapeuten zu liegen. Der
hilflose Helfer ist noch die freundlichste Umschreibung dieses Sachverhaltes.
Unstrittig ist inzwischen, daß die therapeutische Beziehung das eigentlich
Heilsame in der Psychotherapie ist. Was diese Beziehung jedoch ausmacht, ist
durchaus unklar. "'Alle, die ich als gute Analytiker schätze, sind auch
privat gut beziehungsfähig', meinte ein alter, erfahrener Psychoanalytiker, den
ich selbst befragt habe; nicht lange nachher allerdings erfuhr man, daß sein
bester Analytiker-Freund nicht nur ein Verhältnis mit einer Patientin
angefangen hatte, sondern daß dessen Ehefrau sich in der
Institutsöffentlichkeit recht eindeutig über die dubiosen
Beziehungsqualitäten ihres Mannes ausgelassen hatte." (63f) Also alles
Scharlatane? Beleg dafür, daß Psychoanalytiker keine Menschenkenntnis
haben?
Jaeggi versucht sich der Persönlichkeit des Therapeuten - mit aller
Vorsicht - über vier Typen zu nähern. Da gibt es die Idealisierer, die in allen
Schulrichtung angetroffen werden können; ferner die Anhänger der "Rogers-Variablen"
Wärme, Akzeptanz, Einfühlung und Echtheit; die distanzierten Skeptiker, die
sich nicht hineinziehen lassen wollen und schließlich die Abgebrühten, die
nicht weit entfernt sind vom Zynismus.
Um der Verausgabung durch ständige Empathie zu entgehen, bedarf es des
Ausgleiches im Privaten. Leider stehe es damit bei der Zunft auch nicht zum
Besten. Und wie wäre es mit Supervision? Sie schade nicht, sei aber auch kein
Allheilmittel, zumal die Darstellungen der Fälle aus den unterschiedlichsten
Motiven geschönt werden.
Blieben noch die eher verkrampften Feste unter Psychoanalytikern, die sehr
lockeren unter Gestalttherapeuten zu erwähnen - und man wendet sich ab mit
Grausen?
Insgesamt entsteht eher ein Negativbild, das dem Klischee in der
Bevölkerung sehr nahe kommt. Nimmt man noch die Machtspiele und den
Machtmißbrauch in allein seinen Facetten hinzu, dann wundert man sich, wieso
immer noch so viele Gesundungen durch Behandler aller Richtungen zustande
kommen. Und diejenigen, die an den möglichen, allzumenschlichen Bemühungen
scheitern, wenden sich von erkenntniskritisch-aufklärerischer Psychotherapie
den höheren Weihen der Esoterik zu, um so den Druck von Verantwortlichkeit und
menschlicher Beschränkung loszuwerden.
Fazit: Auch Psychotherapeuten sind Menschen. Und wenn sie nicht die höheren
Weihen haben wie die Priester, die diese selbst dann behalten, wenn ihr privates
Leben nicht vorbildlich ist, dann sollten sie sich inne bleiben, daß sie
Mittels wissenschaftlicher (bei Leibe nicht nur naturwissenschaftlicher)
Erkenntnisse der Menschheit versuchen einen gangbaren Lebensweg zu finden; für
sich selbst und Hilfestellung gebend für ihre Patienten. Letztlich bedeutet
dies, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln und zu entfalten, also zu
streben, nicht perfekt sein zu müssen.
Im ganzen scheint mir das Buch die Enttäuschung der Autorin
widerzuspiegeln: "Alles in allem war ich von vielen Interviews enttäuscht,
weil ich das Gefühl hatte, hier wurde vor allem das Gesicht gewahrt und nicht
die Gelegenheit wahrgenommen, offen über einen schwierigen Beruf zu sprechen...
Trotz langjähriger Erfahrung in diesem Berufsfeld und gegen alle Erfahrung habe
ich gedacht, daß Psychotherapeuten vielleicht, wenn man sie nur lange genug
befragt, allgemeinmenschliche 'Weisheiten' zutage fördern würden." (24)
So etwas habe sie noch am ehesten bei Yalom oder Bugental gefunden.
Verwunderlich, daß Frau Jaeggi bei ihren Recherchen nicht auf den
Großgruppentherapeuten Josef Rattner gestoßen ist, der immerhin in derselben
Stadt lebt und praktiziert und sicher als einer der philosophischen Köpfe
unserer Zunft bezeichnet werden kann. Hier hätte sie einiges finden können -
natürlich in menschlicher Form. Greifen hier wohl die Vorurteile der Autorin,
die sie sonst den sie enttäuschenden Kolleginnen und Kollegen attestiert?
Bonn, August 2004
Dipl.-Psych. B.Kuck 
direkt bestellen

Und wer therapiert die Therapeuten?